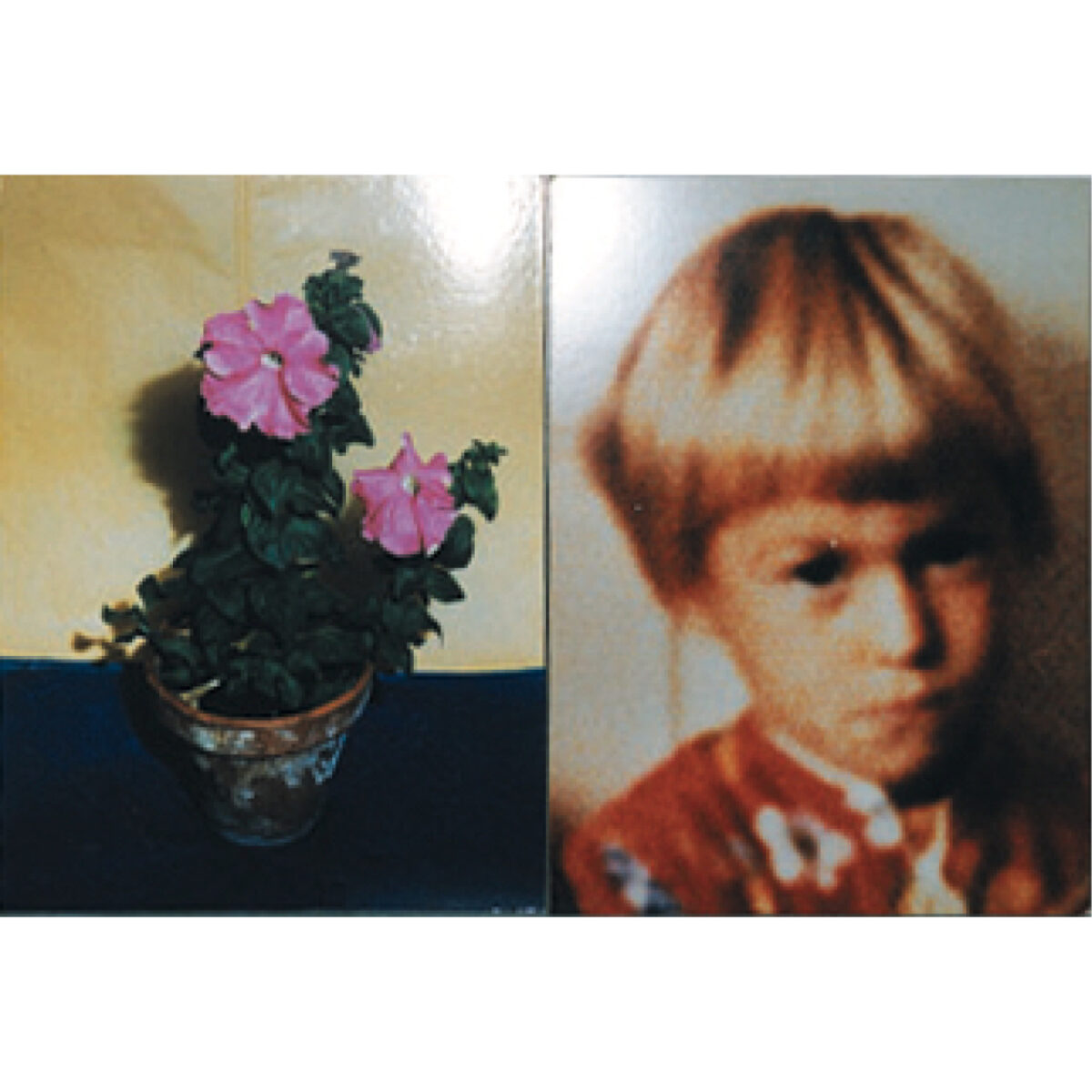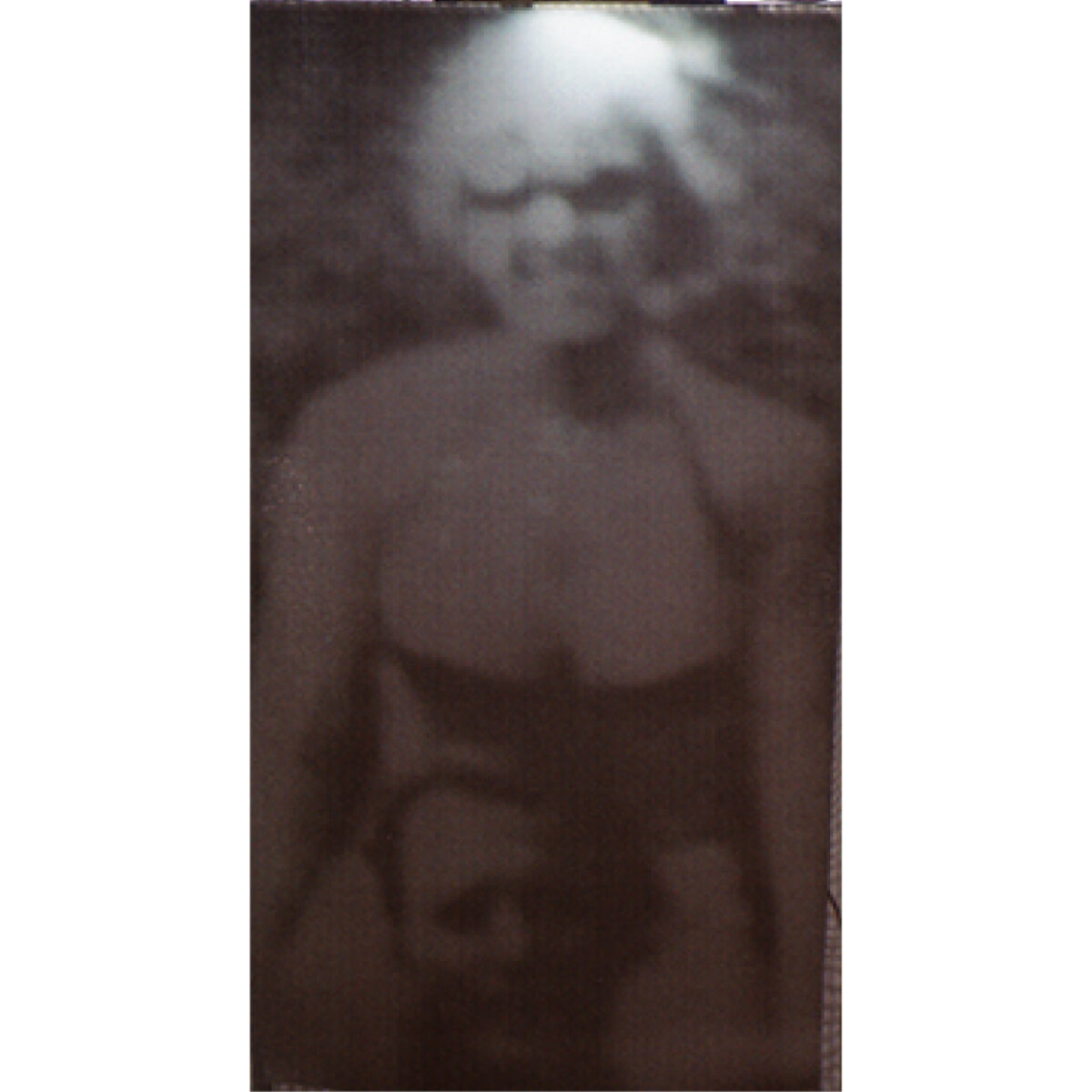Born 1944 in Paris, lebt und arbeitet in Malakoff bei Paris
Problemlos könnte der aufgerichtete Kasten einen Menschen fassen und dessen letzte Ruhestätte bilden. Sein kühles Metall anstelle des organischen Holzes lässt jedoch weniger an einen Sarg, sondern vielmehr an ein archivarisches Behältnis denken. Den Grund nimmt eine schwarz-weiß-Fotografie ein. Ein Schnappschuss von einer Frau im Bikini, die auf den Schultern eines jungen Mannes sitzt. Die ausgelassene Leichtigkeit einer Urlaubsfotografie steht im Kontrast zu der Morbidität ihrer Präsentation. Diese unterstützt mit der durch die Vergrößerung der Reproduktion noch verstärkten Unschärfe den Vergänglichkeitscharakter der Fotografie. Der zukünftige Tod des Dargestellten – wie er nach Roland Barthes von der Fotografie angezeigt wird – ist hier durch ein vermitteltes Bewusstsein über den bereits eingetretenen Tod in die Gegenwart geholt. Den Fotografien werden in diesen wie in weiteren Werken Christian Boltanskis der Reihe Reliquiare, les lignes Textilien beigelegt. In der Arbeit aus dem Jahr 1999 sind es weiße Tücher, die unordentlich am Fuße der Fotografie liegen. Die materielle Körperlichkeit der Knäuel bildet einen Gegenpol zu der dem fotografischen Medium eigenen Glätte und reduzierten Stofflichkeit. Zwischen der haptischen Anwesenheit der Tücher und der physischen Abwesenheit der Fotografierten wie der Toten baut sich so ein unmittelbarer Spannungsbogen zwischen Präsenz und Transzendenz auf. Berührungsreliquien heißen im religiösen Kontext Objekte, die nicht Teil der Person selbst sind, sondern mit denen sie in Kontakt kam. Eines der bekanntesten ist das Tuch der Veronika, an dem Jesus sein verschwitztes Gesicht beim Kreuzgang drückte. Gleich einer Fotografie blieb sein Antlitz darauf erhalten. Die Protagonisten in Boltanskis Arbeiten sind jedoch keine Heilige, sondern ‚unbedeutende’ Unbekannte. Boltanski gibt ihnen einen Platz in seinem künstlerischen Archiv des Lebens und Sterbens.
Die Thematik von Identifikation und Vergänglichkeit im Bezug zu Fotografien und persönlichen Überbleibseln findet sich schon in den frühen Werken pseudo-dokumentarischer Rekonstruktionen des eigenen Lebens wieder. Mit dem Bekenntnis zu seiner jüdischen Herkunft ab 1990 setzt die Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Holocaust ein. Neben Schattenspielen gehören Soundinstallationen zu der immateriellen Dimension seines um die Fragen nach Tod und Erinnerung kreisenden Oeuvres. Boltanski gehört zu den weltweit anerkanntesten Künstlern und ist mehrfach ausgezeichnet. Seine Werke werden international in wichtigen Museen und Kunstausstellungen wie der documenta gezeigt. Im Jahr 2011 nahm Boltanskis Installation Chance den gesamten Französischen Pavillon auf der 54. Internationalen Kunstbiennale von Venedig ein.
Text von Cora Waschke