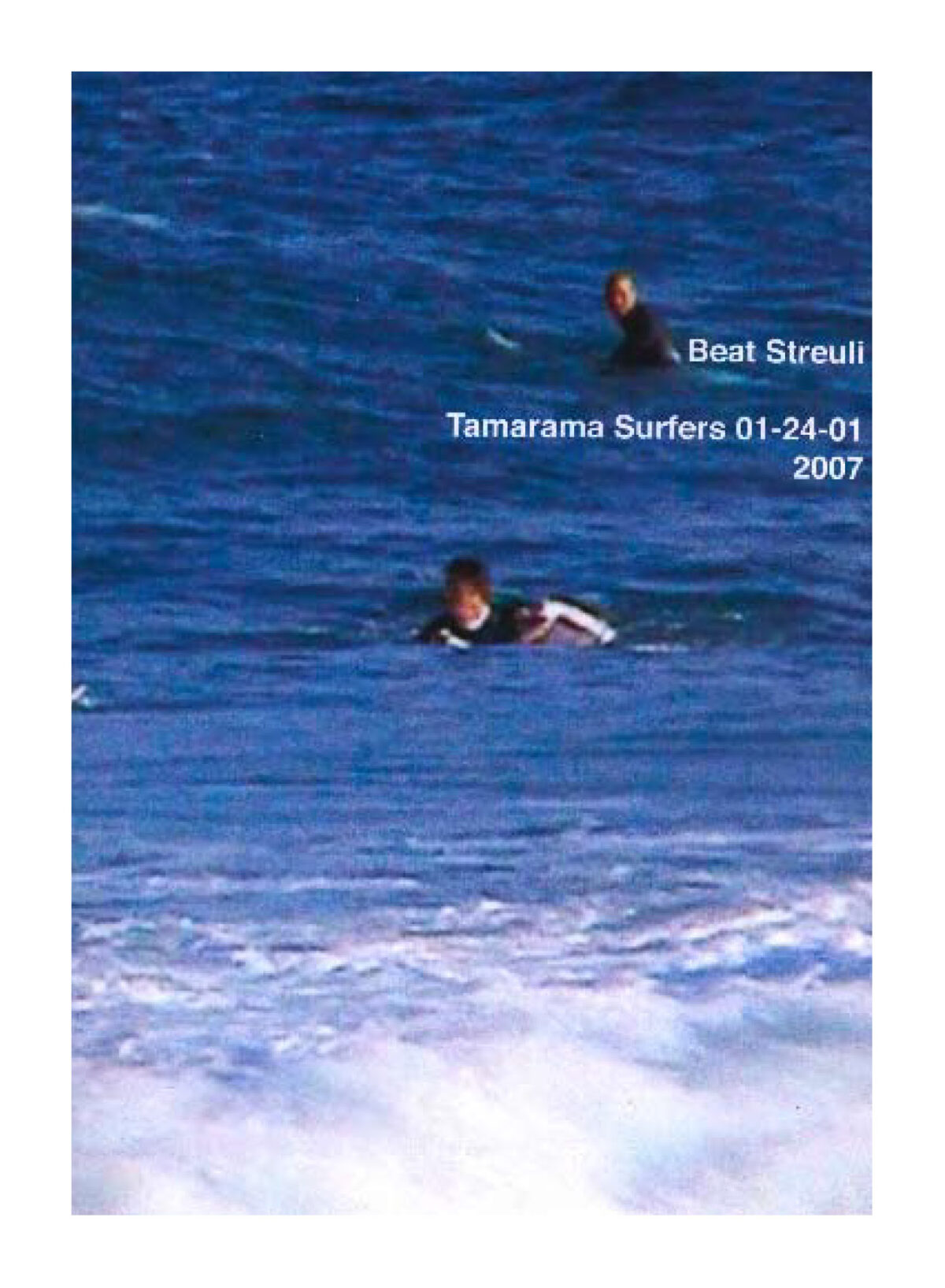Geboren 1957 in Altdorf, Deutschland, lebt in Zürich
Das Individuum und die Menge – dieses Thema tauchte seit dem 19. Jahrhundert immer häufiger nicht nur in der Sozialtheorie, sondern auch in der Literatur auf. Es wurde von dem amerikanischen Autor Edgar Allan Poe, dem französischen Dichter Charles Baudelaire und auch dem bulgarischstämmigen Schriftsteller Elias Canetti aufgegriffen. Sein Buch „Mengen und Macht“ ist ein Klassiker über die Verbindung von Massen und Macht – ein Phänomen, das das 20. Jahrhundert stark beeinflusste. Die Menge, die alles niedertrampelt, die Menge, die Individuen zu willenlosen Teilen des Ganzen macht, die Menge, die jeden Versuch, ein Individuum zu sein, erstickt… Dennoch müssen sich Künstler individuell ausdrücken, und es ist überraschend, dass so wenig Aufmerksamkeit der Kunst dieses Verhältnisses zwischen Individuum und Menge geschenkt wurde.
Beat Streuli ist eine Ausnahme. Das „Individuum und die Menge“ ist sein spezifisches Thema. In New York, Tokio, Zürich, Düsseldorf und Sydney taucht er in die fließende Menge ein, entfesselt den pulsierenden Rhythmus der Masse und verschmilzt mit ihr – abgesehen von einem kurzen Moment, in dem er scheinbar aus der Menge herausragt, sein Teleobjektiv auf eine Einzelperson richtet und aus sicherer Distanz ein Foto macht. Mit dieser Handlung holt er diese Person aus dem unerbittlichen Rhythmus der Menge heraus – und stellt für einen Moment ihre Individualität wieder her. Streuli vergrößert diese Fotos und projiziert sie manchmal an Wände von Gebäuden oder installiert sie in öffentlichen Räumen, wie in Flughafenhallen.
Auf diesen riesigen Fotos sehen wir Gesichter, manchmal Teile ihrer Körper; eine energetische Frau, die mit einem Kind im Arm über ihre Schulter schaut, ein junges japanisches Mädchen mit entferntem Blick, ein selbstbewusster Mann, der in einem teuren Anzug stolzieren, zwei junge Mädchen mit fließendem Haar, die die Augen vor der grellen Sonne zusammenkneifen, eine afrikanische Frau, die ins Leere starrt… Ihre Blicke wirken oft distanziert, sogar abwesend, trotz einer gewissen Vorsicht, die eher von ihren festgehaltenen Körpern als von ihren Blicken ausgeht. Sie befinden sich in ständigem Bewegungsdrang, verursacht durch ihren unbewussten Versuch, mit der Menge mitzuhalten, ein verlässlicher Teil dieses pulsierenden, manchmal niemals endenden Geschehens zu sein, das manchmal noch nicht einmal begonnen hat. Und plötzlich, als ob all diese Menschen, die in Städten auf der ganzen Welt, Tausende von Kilometern voneinander entfernt, mit sehr unterschiedlichen Kulturen und Religionen gefangen wurden, eines gemeinsam hätten: ein fragmentarischer Blick, eine offensichtliche Abwesenheit des Geistes und dennoch eine angeborene Fähigkeit, dem Rhythmus der pulsierenden Menge zu verfallen.
Text von Noemi Smolik