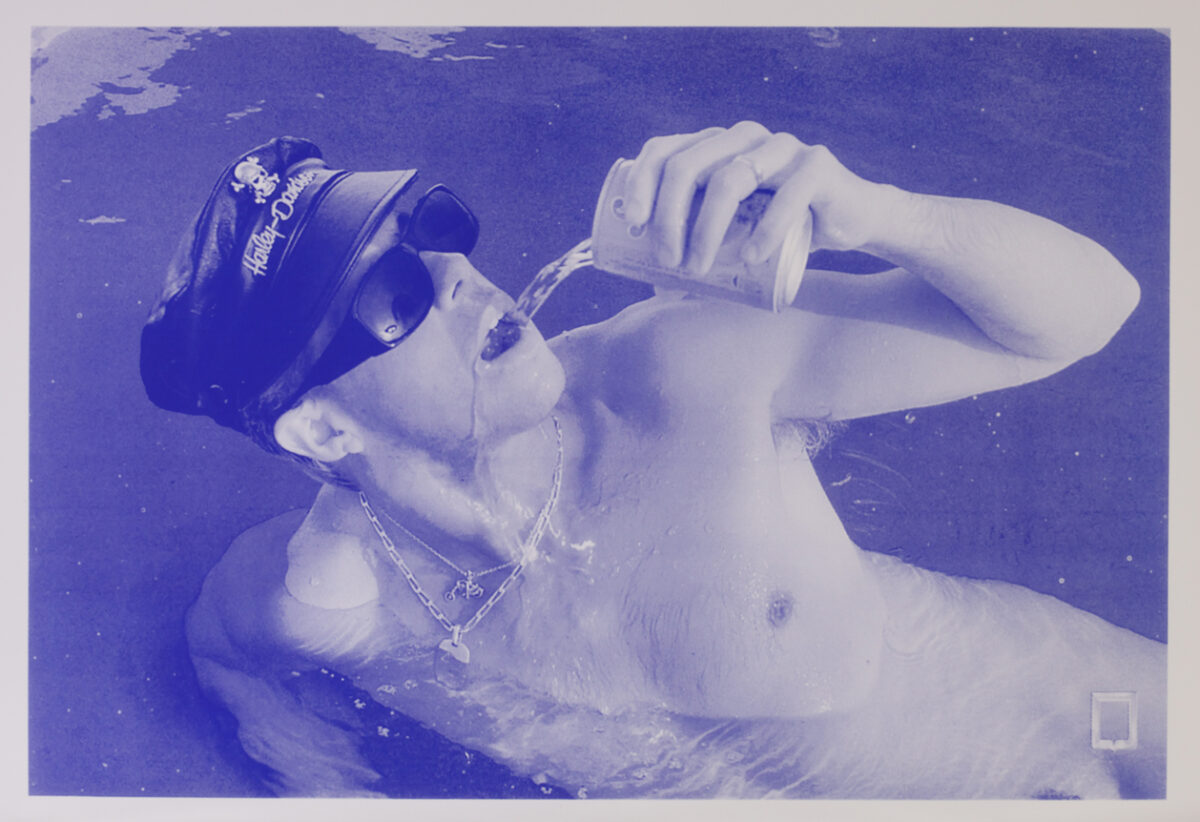Geboren 1956 in Essen, wohnhaft in Düsseldorf
Katharina wurde über Nacht bekannt, als sie 1987 während der Ausstellung „Skulptur Projekte“ in Münster, Deutschland, eine lebensgroße, zitronengelbe Madonna in einem Einkaufsgebiet errichtete. Aus Polyester gefertigt, war die Madonna eine größere Version der berühmten Lourdes-Skulptur. Sie stand mitten im alltäglichen Trubel, die Hände zum Gebet gefaltet, der Kopf von einem Schleier bedeckt, und erweckte den Eindruck, als sei sie gerade aus einer anderen Welt gekommen.
Ihre gelbe Farbe verlieh dieser heiligen Skulptur eine banale Erscheinung, die an den Pop-Art-Künstler Andy Warhol erinnerte. Auf diese Weise kamen zwei Ebenen in dieser Statue zusammen: das Materielle und das Heilige. Und genau das wollte Fritsch erreichen. „Die Materialität verliert sich in meiner Arbeit und wird unwichtig. Und doch ist sie wichtig, aber nur in dem Maße, dass sie den Eindruck der Unkörperlichkeit erzeugt… Deshalb haben meine Skulpturen oft eine matte Oberfläche, damit sie die Umgebung nicht reflektieren. Das verstärkt das Gefühl einer immateriellen Erfahrung“, erklärt Fritsch. Dieses Phänomen wurde früher als Aura bezeichnet, bevor es in der modernen Kunst der 1930er Jahre vom deutschen Kulturkritiker Walter Benjamin eliminiert wurde.
In der Tat. Seit Benjamins Zeit gibt es die Vorstellung, dass nicht nur technisch reproduzierte, sondern auch technisch geschaffene Kunstwerke wie Film, Fotografie und im Falle von Fritsch Skulpturen sich von der Aura befreien können und zu allgemein zugänglichen säkularisierten Objekten werden, die keine kontemplative Herangehensweise erfordern. Genau dieser Gedanke ist jedoch das, wogegen Fritsch arbeiten möchte. „Obwohl wir in einer post-religiösen Ära leben und Künstler keine Priester sind, bedeutet das nicht, dass wir Konzentration, kraftvolle Bilder und Objekte der Aura aufgeben sollten. Wir Künstler haben die Aufgabe, Erfahrungen zu konzentrieren, nicht alles einfach zufällig um uns herum fließen zu lassen, sondern kontemplativ auf Dinge zu fokussieren. Das haben wir von der Religion geerbt.“
Ihre farbenfrohen Reproduktionen, wie die Statuen von St. Katharina, St. Georg oder so banale Motive wie Ratten, Schlangen oder ein riesiger Elefant, den sie manchmal auch in Miniaturform als gewöhnliche Ware auf Regalen präsentiert, oszillieren zwischen einer Aura, die das, was das Materielle übersteigt und daher unsichtbar ist, anzeigt und der Banalität der bloßen Sichtbarkeit. Oder wie der einflussreiche Kunsttheoretiker Thierry de Duve erklärt: Heute sehen wir, dass das Unsichtbare immer noch existiert „und dass keine Vermittlung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren existiert“. Und genau ihr Werk weist auf diese unmögliche Vermittlung hin, manchmal sogar auf eine raffinierte Weise in großen Druckbildern banaler Motive, die aus den Postkarten der Künstlerin stammen.
Text von Noemi Smolik